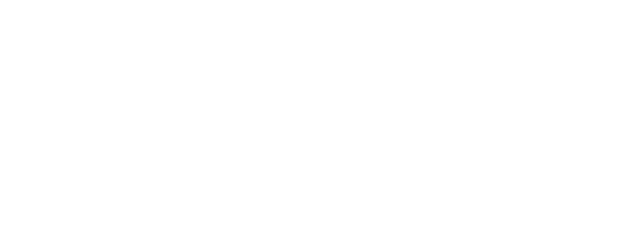Hernán ist gerade von seinem Medizinpraktikum nach Caracas zurückgekehrt. Die Reise von der Mission San Francisco de Guayo dauerte sieben Stunden auf dem Fluss und zehn Stunden auf der Straße. Erschöpft spricht er langsam, wägt seine Worte ab, wie jemand, der zwischen den Erfahrungen und einigen düsteren Überlegungen, die ihn in diesen Monaten beschäftigt haben, unterscheiden muss.
Die Guayo-Mission ist die Heimat von etwa 1.500 indigenen Warao (Kanu-Völkern), die in Palafitos (Pfahlbauten auf überschwemmungsgefährdetem Land) am Ufer des Orinoco-Deltas im äußersten Osten Venezuelas leben. Es gibt ein kleines Krankenhaus, eine Kirche, eine Schule und sonst wenig. Das Missionsspital versorgt etwa zwanzig kleine Gemeinden, die in einem Labyrinth aus Wasser und Dschungel verstreut sind. Sie sprechen kein Spanisch. In ihren mauerlosen Palästen haben die Waraos kein Trinkwasser außer dem, was sie vom Regen auffangen. Sie ernähren sich von Fischen, Knollen und Maispflanzen.
Die Waraos sind das friedlichste der präkolumbianischen Eingeborenenvölker. Sie zerstreuten sich über das Delta, um kriegerischen Stämmen zu entkommen. Die Männer fischen, die Frauen kümmern sich um die Kinder und stellen Kunsthandwerk her, das sie so gut es geht verkaufen. Trotz zunehmender Enkulturation bleibt die Kluft zwischen den beiden Welten groß. Das ist es, was den jungen Arzt quält, wenn er im Folgenden Guayos Mission beschreibt.
Unter kritischen Bedingungen
Im Dorf gibt es keinen ständigen Arzt. Nur diejenigen von uns, die Auszubildende sind. Die Kontinuität der medizinischen Versorgung hängt von drei Krankenschwestern ab, von denen zwei Kapuzinerinnen sind. Das nächstgelegene allgemeine Krankenhaus ist mehrere Stunden Fahrt entfernt. Manchmal haben wir mehr als hundert Patienten pro Tag. Einige von ihnen kommen mehr als drei Stunden mit dem Ruder von ihren Siedlungen, die über das Delta verstreut sind.
Nach und nach übernahmen wir die Situation. Diese Gemeinschaften befinden sich in einer ernsten Überlebenskrise. Einige sind durch zwei weit verbreitete Krankheiten ausgerottet worden: Tuberkulose und HIV.
Fast die Hälfte der Geborenen wird das fünfte Lebensjahr nicht erreichen. Die sehr hohe Säuglingssterblichkeit ist auf Dehydrierung zurückzuführen, die hauptsächlich durch Durchfallerkrankungen verursacht wird. Außerdem ist das Wasser, das mit staatlichen Tankwagen angeliefert wird, nicht gesund.
Die allgemeine Mangelsituation in den öffentlichen Krankenhäusern wird in Guayo auf grausame Weise verschlimmert. Die Behandlung von Tuberkulose und HIV ist teuer und knapp.
Allmählich begriffen wir, dass es sich um einen geduldigen Kampf handelte: Wir mussten die Illusion trotz der Schwierigkeiten am Leben erhalten und alles tun, was wir konnten. Die waraos sind nicht sehr überschwänglich in ihren Dankesbekundungen. Zunächst waren wir schockiert, denn im Gegensatz zum Rest des Landes versäumen es dankbare Patienten nicht, dem Arzt in irgendeiner Form zu danken. Doch auch wenn wir diesen kulturellen Unterschied nicht ganz verstanden, so trieb uns doch der Wunsch zu dienen.
Wir haben uns lange mit den Dorfbewohnern unterhalten. Wir würden die Palafitos betreten, um mit ihnen zu teilen und in ihre Welt einzutauchen. In Guayo fließt die Zeit mit Unterbrechungen. Es gibt Zeiten intensiver Aktivität im Krankenhaus oder in den extremen Gemeinden und sehr ruhige Stunden in der Abenddämmerung.
Die Attraktivität des Dienstes
Die Aussichten sind jedoch nicht düster. Die Schwierigkeiten sind mit Hoffnung verwoben. Es ist paradox, aber Guayo ist ein Magnet für große Herzen. Am gegenüberliegenden Ufer wohnt ein französisches Ehepaar. Louis ist Arzt und Ada ist Anthropologin. Sie leben seit zwölf Jahren in dem Dorf. Sie lieben die waraos und sie haben viel Gutes bewirkt. Sie betrieben ein Gasthaus, in dem sie eine Wasseraufbereitungsanlage hatten, die auch das Dorf versorgte. Als der Tourismus zurückging, beschlagnahmte die Regierung die Anlage. Jetzt müssen sie sich mit einer winzigen Anlage begnügen.
An angehenden Ärzten herrscht nie ein Mangel. Als ich eines Nachmittags von meinem Rundgang durch einige der entlang der Canyons verstreuten Gemeinden zurückkehrte, stolperte ich fast über einige Kinder, die Bilder auf die Bretter der Gehwege zwischen den Palafitos malten. Es war ein Wettbewerb, bei dem es Geschenke für die Heiligen Drei Könige zu gewinnen gab. Es wurde von Natalia organisiert, einer Medizinstudentin, die nach ihrem Praktikum aus Caracas mit einer Ladung Kleidung, Medikamenten und Spielzeug zurückgekehrt war. Natalia absolvierte ihr medizinisches Praktikum in einer anderen Gemeinde, aber sie kam immer wieder nach Guayo, um zu helfen.
Kapuziner-Terziarinnen von der Heiligen Familie
Die Mission von San Francisco de Guayo wurde 1942 von Pater Basilio de Barral gegründet. Als Gelehrter der Warao-Sprache veröffentlichte er einen Katechismus und mehrere didaktische Werke in dieser Sprache. Später kamen die Kapuziner-Tertiärmissionare hinzu, die der Mission Dauerhaftigkeit verliehen haben.
Schwester Isabel López kam sehr jung, 1960, aus Spanien. Sie hat eine Ausbildung als Krankenschwester und arbeitet seit mehreren Jahrzehnten im Delta. Sie hat gesehen, wie das Dorf wuchs und die Evangelisierung zunahm. Heute trägt das Krankenhaus in Guayo ihren Namen, aber das macht ihr nicht viel aus. Schwester Isabel hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Während sie gemächlich durch das Dorf spaziert, verbreitet sie Optimismus und Hoffnung um sich herum. Als ich eines Nachmittags von einem Rundgang durch die Gemeinden zurückkehrte, war ich völlig entkräftet; groteske Bilder und Erinnerungen überfluteten mich wie eine Wolke von Moskitos in einem Mangrovensumpf in der Abenddämmerung. Isabel sah mich kommen und spielte die Finderin. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es hat mich wieder begeistert. Ich bin immer noch erstaunt, mit welchem Geschick sie Süßigkeiten an die Kinder verteilte, die an ihrem Habit zerrten, während wir uns unterhielten.
Einige Vertraulichkeiten
Natalia konnte einige von Schwester Isabels Vertraulichkeiten in einem improvisierten Interview aufzeichnen, das ich hier wiedergebe.
Sagte die Schwester: "Sehen Sie, ohne die Liebe von Jesus Christus würde ich nichts tun. Jesus ist das Zentrum meines geweihten Lebens, meines geistlichen Lebens und meines Gemeinschaftslebens. Ohne ihn würde ich nichts tun. Er ist meine Stütze, deshalb bin ich hier, und sieh nur, wie glücklich ich in dem Alter bin, in dem ich bin. Das ist eine außergewöhnliche Sache. Hören Sie mir zu, Doktor: Wenn ich wiedergeboren wäre, würde ich Kapuziner-Terziar der Heiligen Familie und Missionar werden. Hundertprozentig missionarisch, und mit einem Lächeln, denn ich war schon immer sehr fröhlich und habe mein Lächeln nie verloren. Ein bisschen älter, ja, weil du älter bist, aber du verlierst dein Lächeln nicht.
Die ursprüngliche Motivation, hierher zu kommen, war die Evangelisierung, um Menschen zu Christen zu machen, denn in Guayo gab es nichts. Meine derzeitigen Beweggründe sind immer noch dieselben oder sogar noch größer. Ich habe viel Hoffnung, viel Sorge für die Menschen, für das, was wir in Guayo sehen: die Krankheit, die Armut, die Kinder, die sterben.
Manche Leute kritisieren, dass Missionare zu paternalistisch sind. Aber ich kann nicht anders: Ein Kind kommt zu mir nach Hause und ich gebe ihm kein Bonbon? Meine Vorliebe gilt Kindern und älteren Menschen. Und die Kleinen sehen mich an und sehen etwas: Zuneigung. Ich möchte viele Dinge haben, die ich den Kindern geben kann, auch wenn man mir nachsagt, ich sei paternalistisch oder maternalistisch.
Natalia fragte Schwester Isabel dann, was ihre Ängste oder schwierigsten Momente gewesen seien. Sie antwortete wie folgt: "Ich hatte nicht viele schwierige Momente, ich war sehr glücklich und fühle mich immer wohl. Schwierige Momente? Nun, wenn man so viel Armut sieht, wenn man sieht, wie Menschen sterben. Der Fluss beeindruckt mich sehr. Wenn man das Wasser sieht, steigt man in ein Boot und weiß nicht... Ich habe viele Gefahren auf dem Fluss erlebt. Aber sehr wenige schwierige Momente. Ich war sehr glücklich, sehr glücklich, sehr engagiert.
Ich bin nicht müde. Die Leute sagen, dass Isabel ein Stieglitz ist. Aber ich bin siebenundsiebzig Jahre alt und habe manchmal nicht die Kraft dazu. Das zeigt sich in meiner Arbeit, aber natürlich sehr gut. Ich fühle mich nicht alt. Mir geht es genauso. Ich habe Ihnen gesagt: Nach 56 Jahren kommt es mir wie gestern vor, und ich habe nichts getan. Ich habe das Delta nicht verlassen".
Ein Arzt im Orinoco-Delta
Um in Venezuela als Arzt praktizieren zu können, muss jeder Student ein einjähriges, überwachtes Praktikum absolvieren. Sie werden in der Regel in armen Gebieten durchgeführt, aber es besteht die Möglichkeit, in der Stadt zu arbeiten und einen gewissen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Es gibt keinen Mangel an Studenten, die die schwierigsten Gebiete und Bedingungen in der Peripherie suchen.
Alfredo Silva hat an der Zentraluniversität von Venezuela in Caracas Medizin studiert und steht kurz vor dem Abschluss seines Praktikums, das er bei der indigenen Bevölkerung des Orinoco-Deltas absolviert, in jenem Gewirr von Kanälen, in dem der Fluss vor der Mündung in den Atlantik versickert. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt.
Warum haben Sie sich entschieden, Ihr Praktikum hier zu absolvieren? -Ich war in den Osterferien 2006 zum ersten Mal im Delta. Es handelte sich um ein von meiner Schule organisiertes Freiwilligenprogramm. Wir machten Sozialarbeit und katechetische Aktivitäten. Der Ort und die Menschen haben mich überzeugt.
Im Jahr 2014, im sechsten Jahr meines Studiums, ging ich für zwei Monate zurück. Ich habe Jan, einen Kommilitonen, mitgebracht. Es war sehr bereichernd. Wir fühlten uns nützlich. Wir haben gesehen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben. Wir könnten vielen helfen und denen, die keine haben, eine Chance geben.
Anfang 2015 haben wir beschlossen, unser Abschlusspraktikum hier zu absolvieren. Das war nicht einfach. Wir waren knapp bei Kasse. Andere Reiseziele boten finanzielle Vorteile, während man hierher kommen muss, um Mittel aufzubringen und immer etwas Eigenes beizusteuern. Aber die Medizin war uns sehr ans Herz gewachsen und drängte uns zum Dienst. Seit Jahren spiele ich mit dem Gedanken, bei Ärzte ohne Grenzen mitzumachen, einer Nichtregierungsorganisation, die humanitäre Hilfe in Gebieten leistet, die von Kriegen oder Naturkatastrophen betroffen sind. Aber hier waren wir mit Situationen konfrontiert, die mit denen in Bezug auf Sterblichkeit, Ernährungslage und schwere Krankheiten vergleichbar sind.
Wie haben sich Ihre Beweggründe in diesen Monaten entwickelt? -Ein Professor schlug vor, dass wir eine Studie über Tuberkulose und HIV, die diese Gemeinden heimsuchen, durchführen sollten. Der akademische Aspekt beruhigte viele unserer Verwandten, die sich Sorgen über die Schwierigkeiten machten, die uns erwarten würden. Die Ergebnisse der Studie könnten uns den Zugang zu postgradualen Studien ermöglichen.
Im Laufe der Monate bekräftigte das Elend, das uns täglich begegnete, unsere Motivation, zu helfen, während wir in unserer Forschung vorankamen. Es ist der Weg, sich mit diesem traurigen Paradoxon auseinanderzusetzen: Die Waraos leben im Elend der indigenen Welt, aber sie werden von den Übeln der heutigen Gesellschaft geplagt.
Was waren Ihre schönsten Momente? -Es ist etwas, wonach man nicht sucht. Vielmehr sind Sie überrascht, dass Sie glücklich und erfüllt sind und an den miserabelsten Orten arbeiten. Die Not der anderen gibt Ihnen das Gefühl, nützlich zu sein.
Vor einigen Monaten besuchten wir eine Familie, in der Mutter und Tochter an Tuberkulose erkrankt waren. Der älteste Sohn litt an Unterernährung. Wir trafen die nötigen Vorkehrungen, um die notwendige medizinische Behandlung zu erhalten, die lange auf sich warten ließ. Als wir zurückkehrten, hatte nur der Sohn überlebt. In diesem erbärmlichen Zustand konnten wir den Jungen retten. Es ist sehr anstrengend und braucht Zeit, aber es kann auch sehr bereichernd sein.
Welche Befürchtungen haben Sie gehabt? -Wenn man Zeuge solch starker Situationen wird, möchte man helfen und etwas tun. Es ist die Angst, nicht helfen zu können, weil man gegen etwas ankämpft, das man nicht beeinflussen kann. Das bedeutet einen ständigen Kampf um Motivation. Es ist beängstigend zu denken, dass es irgendwann zusammenbricht, wenn man geht.
Die Waraos sind sehr empfänglich für unsere Hilfe, aber die Mittel reichen nicht aus. Sie brauchen immer mehr. Wenn Sie einer Gemeinschaft dienen, wird diese erwarten, dass Sie jeden Tag kommen. Aber die Medikamente sind begrenzt. Das nächste Krankenhaus ist für sie zu weit entfernt, um mit dem Kanu zu paddeln. Wenn ich versuchen sollte, die Waraos zu beschreiben, würde ich sagen, sie sind geborene Überlebenskünstler. Sie haben nur wenige Hilfsmittel, aber eine Menge Geduld, um mit der heutigen Welt zurechtzukommen. Doch sie kämpfen mit der Freude und dem einfachen Charme des Unberührten. Sie sind immer noch vertrauensvoll, edel und einladend.
Wenn Sie in der Zeit zurückgehen könnten, würden Sie zurückgehen? -Ja, natürlich, absolut. Ich bedauere nichts. Es sind viele gute Dinge passiert und ich habe viel gelernt. Man merkt, dass man nicht so viele Dinge zum Leben braucht.
Caracas