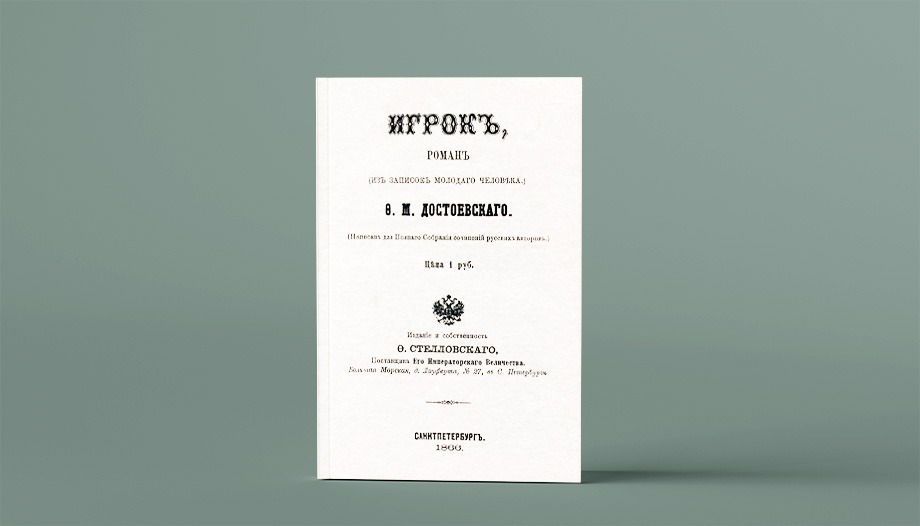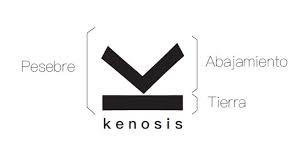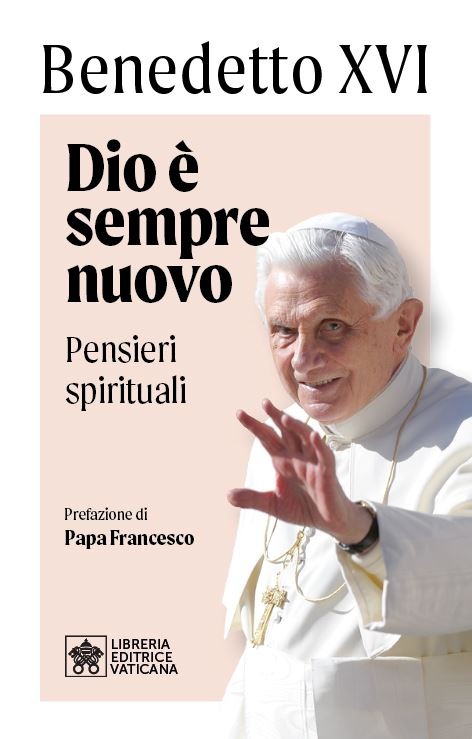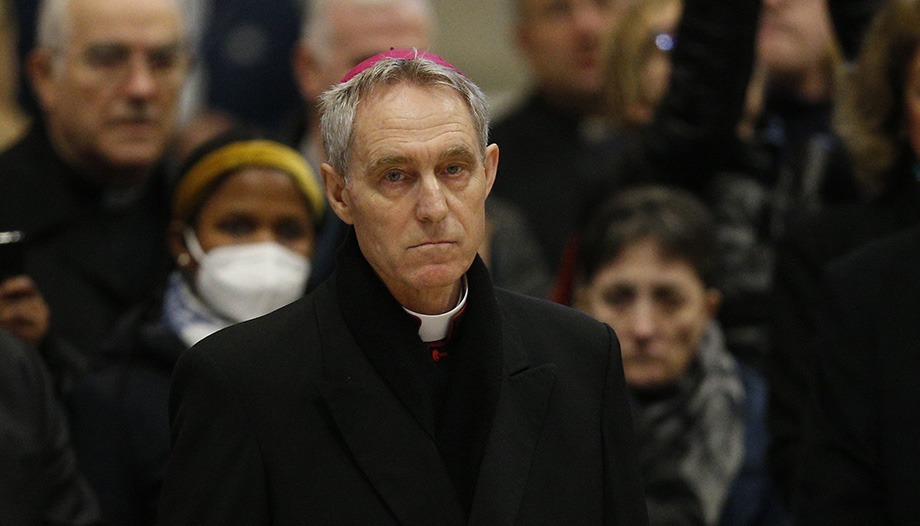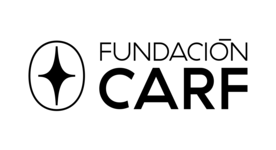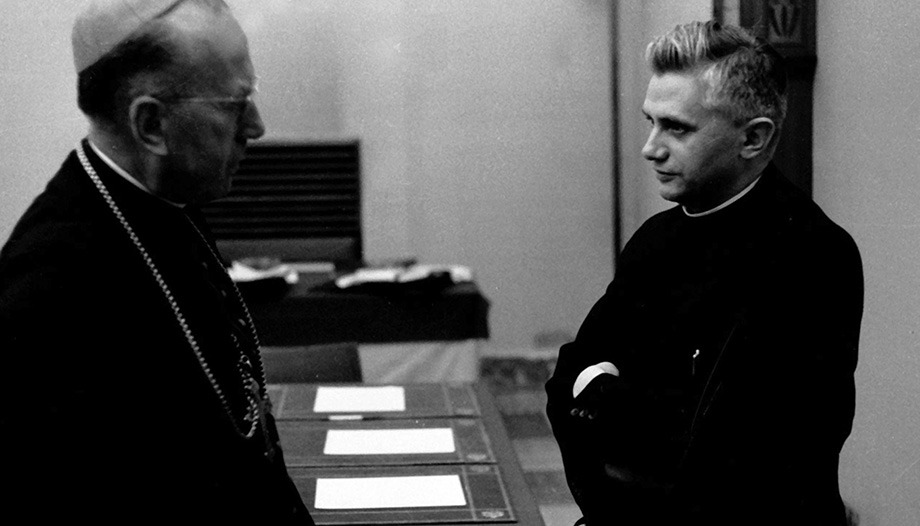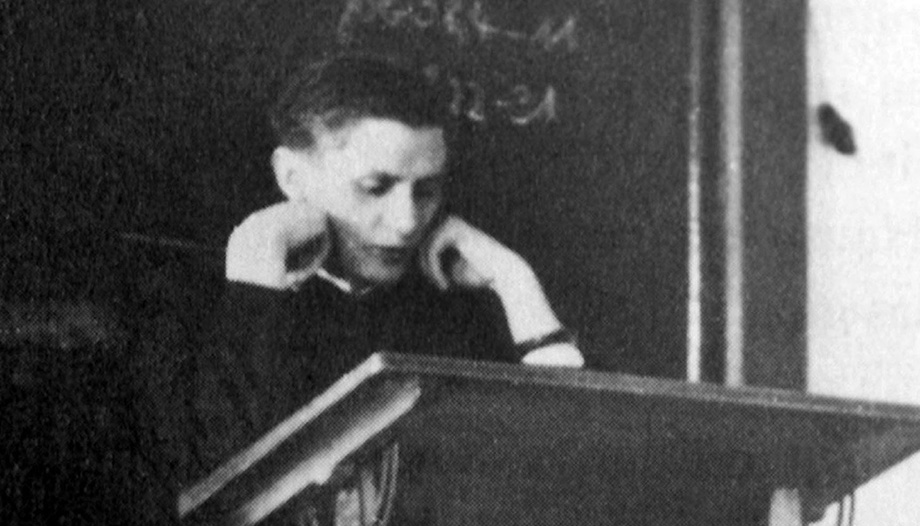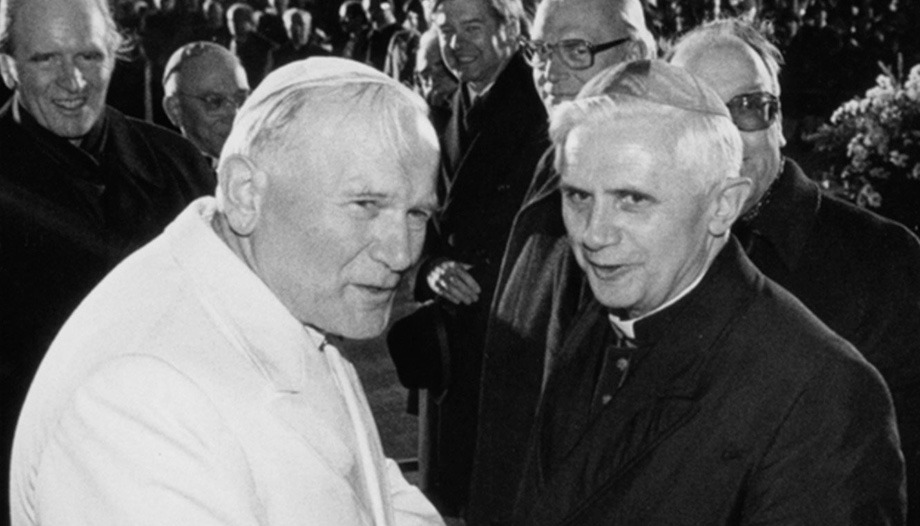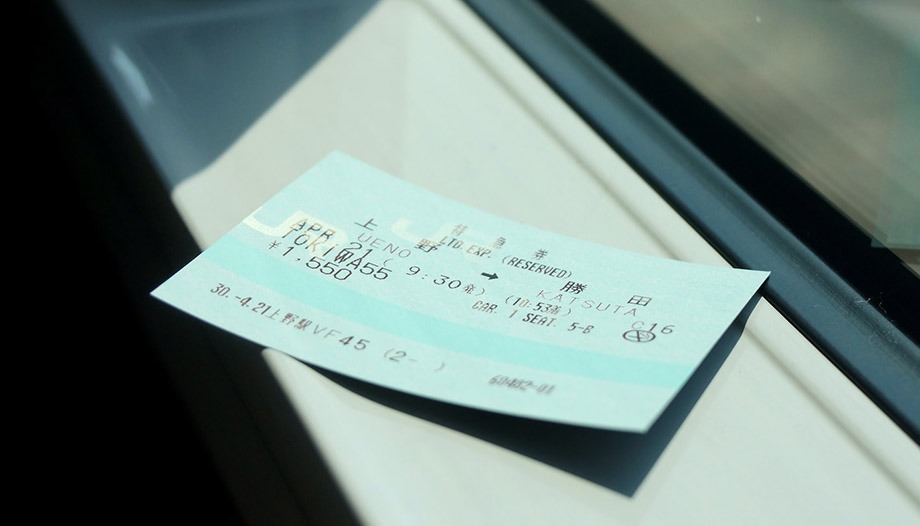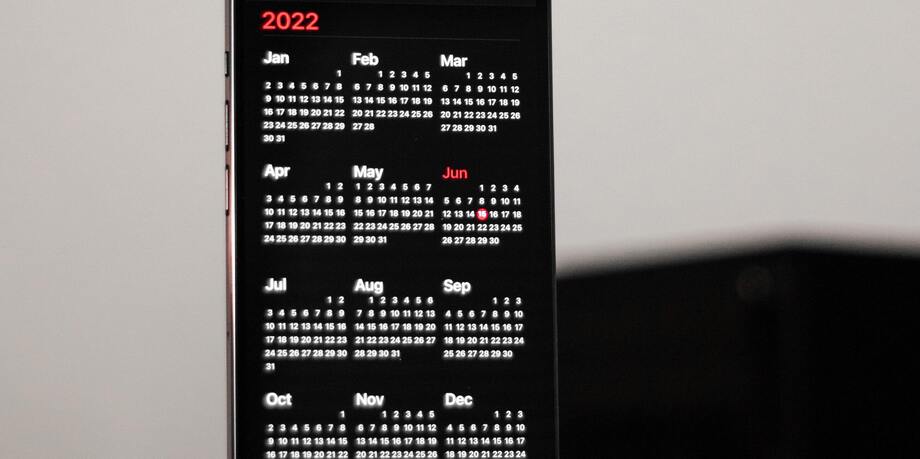Johannes Paul II. hat die Enzyklika gewürdigt Populorum Progressio seines Vorgängers Paul VI. durch die Veröffentlichung der Sozialenzyklika Sollecitudo Rei Socialis vor 35 Jahren, am 30. Dezember 1987. Sie erfolgte 20 Jahre nach der Veröffentlichung der Enzyklika von Papst Montini, die sich in den 1960er Jahren an die Menschen und die Gesellschaft richtete.
Sollicitudo Rei Socialis behält die ganze Kraft des Gewissensappells von Paul VI. bei und bezieht sich auf den neuen sozialgeschichtlichen Kontext der 1980er Jahre, um die Konturen der heutigen Welt aufzuzeigen, immer mit Blick auf das inspirierende Motiv der "Entwicklung der Völker", die noch lange nicht erreicht ist. "Ich schlage vor, ihr Echo zu erweitern, indem ich sie mit möglichen Anwendungen auf den gegenwärtigen historischen Moment verbinde, der nicht weniger dramatisch ist als der von vor zwanzig Jahren", schreibt Johannes Paul II.
Die Zeit fließt - wie wir wissen - immer im gleichen Tempo; heute haben wir jedoch den Eindruck, dass sie einer sich ständig beschleunigenden Bewegung unterworfen ist, was vor allem auf die Vervielfältigung und Komplexität der Phänomene zurückzuführen ist, in deren Mitte wir leben. Infolgedessen hat sich die Konfiguration der Welt in den letzten zwanzig Jahren unter Beibehaltung einiger grundlegender Konstanten erheblich verändert und zeigt völlig neue Aspekte".
Mit Sollicitudo rei socialis (im Folgenden SRS) wird eine Analyse der heutigen Welt angeboten, die der ganzen Wahrheit über den Menschen Rechnung trägt: Seele und Leib, Gemeinschaftswesen und Person mit Eigenwert, Geschöpf und Kind Gottes, Sünder und von Christus Erlöster, Schwacher und durch die Kraft des Geistes Gestärkter.
Die Enzyklika betont die ethische Grundlage der Entwicklung und unterstreicht die Notwendigkeit des persönlichen Engagements aller für ihre Brüder und Schwestern.
Dieses Bemühen um die Entwicklung des ganzen Menschen und jedes Einzelnen ist der einzige Weg, um den Frieden und das relative Glück in dieser Welt zu festigen. Nach Ansicht von Enrique Colom (in AA.VV., Johannes Paul Theologe. En el signo de las encíclicas, Mondadori, Mailand 2003, S. 128-141) "in gewissem Sinne könnte man die Lehre der Enzyklika in einem einzigen Satz voller praktischer Konsequenzen zusammenfassen: "Wir alle sind wirklich für alle verantwortlich" (SRS 38)".
Bekanntlich sind die Enzykliken des Papstes, auch die des Sozialmagisteriums, keine politischen oder soziologischen Dokumente, sondern theologischer Natur.
Eine der am meisten hervorgehobenen Ideen in der SRS ist gerade, dass Armut, Entwicklung, Ökologie, Arbeitslosigkeit, Solidarität usw. eher ethische als technische Probleme sind, und dass ihre wirkliche und dauerhafte Lösung nicht nur in einer strukturellen Verbesserung zu finden ist, sondern auf einem ethischen Wandel beruhen muss, d.h. auf der Bereitschaft, vielleicht mentale und Lebensgewohnheiten zu ändern, die, wenn sie echt sind, die Institutionen beeinflussen werden.
Der Mensch ist eine Person, nicht nur homo faber oder oeconomicus. Daher ist, wie Populorum Progressio lehrte, die wahre Entwicklung für jeden einzelnen Menschen der Übergang von weniger menschlichen Bedingungen zu menschlicheren Bedingungen: "Menschlicher: der Aufstieg von der Armut zum Besitz des Notwendigen, der Sieg über soziale Übel, die Erweiterung des Wissens, die Aneignung von Kultur. Auch menschlicher: mehr Rücksicht auf die Würde des anderen, Übergang zum Geist der Armut, Zusammenarbeit für das Gemeinwohl, Wunsch nach Frieden. Noch menschlicher: die Anerkennung der höchsten Werte und Gottes, der Quelle und Ziel des Menschen ist. Menschlicher schließlich und vor allem: der Glaube, das Geschenk Gottes, das vom guten Willen des Menschen angenommen wird, und die Einheit in der Liebe Christi, der uns alle aufruft, als Kinder am Leben des lebendigen Gottes, des Vaters aller Menschen, teilzuhaben" (Nr. 21). Schon Paul VI. hat, wie später auch Johannes Paul II., ohne die wirtschaftlich-sozialen Aspekte der Entwicklung zu vernachlässigen, die größere Bedeutung des spirituellen und transzendenten Bereichs aufgezeigt.
Gewiss, um sich zu verwirklichen, muss der Mensch Dinge "haben", aber diese reichen nicht aus, es bedarf auch eines inneren Wachstums: kulturell, moralisch, spirituell. Das "Haben" von Gegenständen und Gütern vervollkommnet das menschliche Subjekt nicht, wenn es nicht zur Reifung und Bereicherung seines "Seins" beiträgt, d.h. zur Verwirklichung der menschlichen Berufung als solcher" (SRS 28).
Das Wesentliche ist also die volle Verwirklichung der Person, d.h. mehr zu "sein", in der Menschlichkeit zu wachsen, ohne irgendeine menschliche Tugend zu vernachlässigen, und zwar auf harmonische Weise, entsprechend einer authentischen Wertehierarchie, entsprechend der ganzen Wahrheit über den Menschen. Daher schlägt der Papst weder eine Antinomie zwischen "Sein" und "Haben" vor noch denkt er an eine solche, sondern er warnt vor einem "Haben", das das "Sein" behindert, das eigene oder das eines anderen, und lehrt, dass es im Falle einer Unvereinbarkeit besser ist, weniger zu "haben" als weniger zu "sein".
Das wichtigste Merkmal der Wahrheit über den Menschen hängt von der Tatsache ab, dass er ein Geschöpf Gottes ist, das zu seinem Kind erhoben wurde: Aus diesem Zustand erhält der Mensch seine Beständigkeit, seine Wahrheit, seine Güte, seine richtige Ordnung und sein angemessenes Gesetz. Daher ist die Erfüllung der göttlichen Pläne die einzige wirklich "absolute" Verpflichtung der Person, die sie auf ihre ganzheitliche Fülle ausrichtet; die anderen Verpflichtungen werden nicht aufgehoben, sondern müssen ihr untergeordnet werden.
In der Tat ist die menschliche Entwicklung - so erinnert uns der SRS - "nur möglich, weil Gott, der Vater, von Anfang an beschlossen hat, den Menschen in dem auferstandenen Jesus Christus an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen (...), und in ihm wollte er die Sünde überwinden und sie in den Dienst unseres höheren Gutes stellen, das das, was der Fortschritt erreichen kann, unendlich übersteigt" (SRS 31). Umgekehrt kann der Mensch ohne Gott die Gesellschaft aufbauen und "die Erde organisieren, aber ohne Gott kann er sie letztlich nur gegen den Menschen organisieren. Ein ausgrenzender Humanismus ist ein inhumaner Humanismus" (Populorum Progressio, 42).
Auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich erfüllen sich die Worte Jesu: "Die Freude am Geben ist größer als am Nehmen" (Apg 20,35). Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Gott der Herr des gesamten Universums, jeder Minute und des kleinsten Ereignisses ist; daher wird, wie Johannes Paul II. lehrt, die volle Verwirklichung der Entwicklung vor allem die Frucht der "Treue zu unserer Berufung als gläubige Männer und Frauen" sein. Denn es kommt in erster Linie auf Gott an" (SRS 47).
Leider messen die utilitaristischen Lehren den Fortschritt ausschließlich in immanenten und irdischen Begriffen. Die eklatanten Widersprüche, die in unserer Welt zu beobachten sind, verdeutlichen jedoch "den inneren Widerspruch einer Entwicklung, die sich ausschließlich auf den wirtschaftlichen Aspekt beschränkt. Sie ordnet den Menschen und seine tiefsten Bedürfnisse leicht den Erfordernissen der wirtschaftlichen Planung oder des exklusiven Profits unter (...). Wenn Individuen und Gemeinschaften die moralischen, kulturellen und spirituellen Bedürfnisse, die auf der Würde der Person und der Identität jeder Gemeinschaft, angefangen bei der Familie und den religiösen Gesellschaften, beruhen, nicht strikt respektiert sehen, wird alles andere - die Verfügbarkeit von Gütern, der Reichtum an technischen Ressourcen, die im täglichen Leben eingesetzt werden, ein gewisses Maß an materiellem Wohlstand - unbefriedigend und auf lange Sicht vernachlässigbar sein" (SRS 33).
Dort gehen menschliche Entwicklung und wirtschaftlicher Fortschritt Hand in Hand, wie Johannes Paul II. in Erinnerung rief: "Die moralischen Ursprünge des Wohlstands sind in der Geschichte wohl bekannt. Sie finden sich in einer Konstellation von Tugenden wieder: Fleiß, Kompetenz, Ordnung, Ehrlichkeit, Initiative, Nüchternheit, Sparsamkeit, Dienstbereitschaft, Treue zu Versprechen, Kühnheit, kurzum: die Liebe zu guter Arbeit. Kein System und keine soziale Struktur kann das Problem der Armut ohne diese Tugenden auf magische Weise lösen; auf lange Sicht spiegeln sowohl die Programme als auch die Funktionsweise der Institutionen diese Gewohnheiten des Menschen wider, die im Wesentlichen im Bildungsprozess erworben werden und zu einer echten Kultur der Arbeit führen". Damit die transzendente und die irdische Entwicklung des Menschen in Harmonie leben können, ist es erforderlich, dass jeder Mensch seine Tätigkeiten, einschließlich der sozioökonomischen, so ausübt, dass sie ihren vollen menschlichen Sinn in Übereinstimmung mit der letzten transzendenten Bestimmung des Menschen erreichen; und dass andere Menschen und die Gesellschaft sich des Wertes und der Bedürfnisse jedes Menschen bewusst sind und entsprechend handeln.
Ein Eckpfeiler dieser menschlichen Bedürfnisse ist das Bedürfnis, an der Produktion und dem Genuss menschlicher Güter auf allen Ebenen teilzuhaben; dies gilt heute umso mehr, als die gegenseitige Abhängigkeit zugenommen hat. Dies wird gerade durch den Grundsatz und die Tugend der Solidarität erreicht: eines der häufigsten Themen in den Lehren von Johannes Paul II.
Der Papst betont sie so sehr, einerseits wegen ihrer engen Beziehung zur Nächstenliebe - der Liebe zu Gott und zum Nächsten -, dem Höhepunkt des christlichen Lebens; andererseits, weil unter den gegenwärtigen Bedingungen der technologischen Entwicklung die sozioökonomischen Ungleichheiten das Produkt des Egoismus sind, weil man im anderen keinen Bruder, kein Kind des ewigen Vaters, keine menschliche Person mit der gleichen Würde sieht; mit anderen Worten, sie sind das Produkt eines nicht unterstützenden Verhaltens. Es handelt sich um zwei miteinander verbundene Gründe: der erste ist rein religiöser Natur, der zweite ist sozialer Natur, aber mit einer transzendenten Grundlage.
Der heilige Johannes erinnert uns daran, dass "Gott die Liebe ist" (1 Joh 4,8.16), eine Liebe, die eine ständige gegenseitige Selbsthingabe innerhalb der Dreifaltigkeit ist. Und da der Mensch nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen wurde (Gen 1,26), muss man auch vom Menschen sagen, dass seine innerste Wahrheit in der Liebe, in der Selbsthingabe zu finden ist.
Dies steht in vollkommenem Einklang mit dem "neuen Gebot" Jesu Christi, in dem das ganze Gesetz und die Propheten enthalten sind: Die Nächstenliebe ist das grundlegende Gesetz der menschlichen Vervollkommnung und damit auch der Umgestaltung der Welt. Angesichts der Missverständnisse über den Begriff der Liebe muss jedoch betont werden, dass wahre Liebe Unentgeltlichkeit (Joh 3,16; 15,13) und Dienst (1 Petr 2,16; Gal 5,13) und nicht so sehr das Streben nach dem eigenen Wohl (Mt 16,25) beinhaltet; und sie umfasst alle Dimensionen der Person: keine menschliche Eigenschaft steht außerhalb der Nächstenliebe und der Liebe.
Die brüderliche Dimension ist für das Leben des Christen (und eines jeden Menschen) so wesentlich, dass man sich eine Ausrichtung auf Gott nicht vorstellen kann, die die Bande vergisst, die jeden Menschen mit seinen Brüdern und Schwestern verbinden. Aus diesen Wahrheiten ergibt sich, dass das christliche Leben nicht so gelebt werden kann, als ob die Menschen voneinander getrennt wären.
Im Gegenteil, das Engagement des Menschen für den materiellen und geistigen Fortschritt der gesamten Gesellschaft ist fester Bestandteil der Berufung, mit der Gott jeden Menschen beruft: Die Identifikation mit dem Geliebten, die der Liebe eigen ist, führt dazu, ihn bei allen Handlungen im Auge zu behalten, die als unentgeltliche Gabe für den Geliebten ausgeführt werden.
Das bedeutet, dass die Liebe Gottes ein soziales Engagement verlangt, und dass dieses Engagement in einem authentischen Leben der Liebe seinen festen Grund findet: Nur eine Liebe, die mit der ganzen Wahrheit über den Menschen in Einklang steht, ist in der Lage, ein soziales Leben zu gestalten, das der Person würdig ist.
Diese Realität wird in negativer Weise durch die Entstehung und Entwicklung der "sozialen Frage" bestätigt, und zwar genau zu einer Zeit, als das ideologische Denken Opposition, Kampf und sogar Hass als treibende Kraft der Geschichte bezeichnete.
"Die Welt ist krank", sagte Paul VI. (Populorum Progressio, 66), und es scheint, dass sich die Krankheit seither verschlimmert hat: Man denke nur an die Flüchtlingslager, die Exilanten, die Krisenherde (Krieg, Guerilla und Terrorismus), die rassistischen und religiösen Diskriminierungen, die fehlenden politischen und gewerkschaftlichen Freiheiten, die Fluchtphänomene wie Drogen und Alkoholismus, die Bereiche, in denen Ausbeutung und Korruption institutionalisiert sind, zu Arbeitsplätzen, an denen man den Eindruck hat, als Mittel benutzt zu werden, und zu Orten, an denen Demütigung zur Lebensweise geworden ist, zu Gebieten, in denen Hunger, Dürre und endemische Krankheiten herrschen, zu oft rassistisch motivierten Anti-Natalismus-Kampagnen, zur Verbreitung von Abtreibung und Euthanasie usw. Das heutige Weltbild, auch das wirtschaftliche, scheint dazu bestimmt zu sein, uns immer schneller in den Tod zu führen, anstatt eine echte Entwicklung anzustreben, die alle zu einem "menschlicheren" Leben führt, wie es die Enzyklika Populorum Progressio fordert" (SRS 24).
Wir haben es also mit einem Paradoxon zu tun: Die Menschen kennen - weitgehend - die Kriterien der wahren Entwicklung, sie wollen - weitgehend - das Gute tun und das Böse vermeiden, sie verfügen - in ausreichendem Maße - über die technischen Mittel dazu; dennoch ist die Welt immer noch krank, vielleicht kränker als zuvor. Das Paradox erfordert daher eine Erklärung, die viel tiefer geht als eine sozioökonomische Analyse, die den eigentlichen Ursprung des Übels in der Welt aufdeckt; es erfordert eine Analyse, die den innersten Kern des menschlichen Verhaltens anspricht: eine ethische Analyse, die den Ursprung der ungerechten Strukturen aufdeckt, das heißt, die die Wurzel des unmoralischen Handelns des Menschen, das, was das Christentum Sünde nennt, aufdeckt.
Und die unmoralischen Handlungen eines Menschen sind nichts anderes als die Sünde mit ihren institutionalisierten Folgen - den "Strukturen der Sünde" -, die, indem sie das Verhalten der Menschen konditionieren, zur Quelle anderer Sünden werden: "Die wahre Natur des Übels, mit dem wir in der Frage der "Entwicklung der Völker" konfrontiert sind: Es ist ein moralisches Übel, die Frucht vieler Sünden, die zu "Strukturen der Sünde" führt" (SRS 37). Sicherlich sind "Sünde" und "Strukturen der Sünde" Kategorien, die normalerweise nicht auf die Situation der heutigen Welt angewendet werden. Es ist nicht leicht, zu einem tiefen Verständnis der Wirklichkeit zu gelangen, wie sie sich vor unseren Augen darstellt, ohne die Wurzel der Übel zu benennen, die uns bedrängen" (SRS 36). Und "diese Haltungen und 'Strukturen der Sünde' können - die Hilfe der göttlichen Gnade vorausgesetzt - nur durch eine diametral entgegengesetzte Haltung überwunden werden: den Einsatz für das Wohl des Nächsten mit der Bereitschaft, sich im Sinne des Evangeliums um des anderen willen zu 'verlieren', anstatt ihn auszubeuten, und ihm zu 'dienen', anstatt ihn zum eigenen Vorteil zu unterdrücken (vgl. Mt 10,40-42; 20,25; Mk 10,42-45; Lk 22,25-27)" (SRS 38).
Wer diese moralische Quelle der sozialen Übel nicht erkennen - und beheben - will, wird auch nicht ernsthaft vom Übel geheilt werden wollen; es ist daher notwendig, die eigenen Sünden zu untersuchen, insbesondere - wenn man von den sozioökonomischen Übeln spricht - diejenigen, die das soziale Leben am unmittelbarsten betreffen: Stolz, Hass, Zorn, Gier, Neid usw., ohne sich in eine anonyme Kollektivität zu flüchten; und auch die schädlichen Folgen dieser Sünden im persönlichen, familiären, sozialen und politischen Leben zu erkennen. "Das Böse auf diese Weise zu diagnostizieren, bedeutet, auf der Ebene des menschlichen Verhaltens genau den Weg zu bestimmen, den man einschlagen muss, um es zu überwinden" (SRS 37).
Die Identifizierung der Wurzel des Übels fördert die Suche nach den am besten geeigneten Lösungen und Mitteln zu seiner Ausmerzung. Sie werden, wie das Hindernis, hauptsächlich moralischer Natur sein, sowohl auf der persönlichen Ebene (Sünde) als auch auf der institutionellen Ebene (Strukturen der Sünde): "Wenn die wissenschaftlichen und technischen Mittel zur Verfügung stehen, die zusammen mit den notwendigen und konkreten politischen Entscheidungen schließlich dazu beitragen müssen, die Völker auf den Weg der wahren Entwicklung zu bringen, können die größten Hindernisse nur aufgrund von im wesentlichen moralischen Entscheidungen überwunden werden, die für die Gläubigen, insbesondere die Christen, von den Grundsätzen des Glaubens mit Hilfe der göttlichen Gnade inspiriert sein werden" (SRS 35).
Wir dürfen uns nichts vormachen: Wir werden in der sozialen Gerechtigkeit und Nächstenliebe nicht weiter gehen als in der persönlichen Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Die moralische Haltung einer Gemeinschaft hängt von der persönlichen Bekehrung der Herzen, der Verpflichtung zum Gebet, der Gnade der Sakramente und dem Bemühen um die Tugenden ihrer Mitglieder ab. Der Vorrang der persönlichen Bekehrung schließt jedoch nicht aus, dass ein struktureller Wandel notwendig ist.
In diesem Sinne erinnert der Papst sowohl an einen wirksamen politischen Willen als auch an eine im Wesentlichen moralische Entscheidung (vgl. SRS 35; 38): Ersterer allein könnte - zufällig - einen gewissen Wandel herbeiführen, aber die Erfahrung bezeugt, dass er vergeblich ist und dass oft die verursachten Ungerechtigkeiten größer sind als die behobenen; letzterer ohne Ersteres bliebe wegen seiner Unauthentizität unfruchtbar: Eine wahre innere Bekehrung ist nicht die, die nicht zu sozialen Verbesserungen führt.
Der Begriff der Solidarität ist somit eine Anspielung auf die etymologische Bedeutung -participare in solidum-, die die Gesamtheit der Bindungen bezeichnet, die Menschen miteinander verbinden und sie zur gegenseitigen Hilfe antreiben.
Aus ethischer Sicht wird eine tugendhafte und stabile Handlungsweise in Frage gestellt, die mit einem solidarischen Verhalten in Einklang steht, das als konkretes Engagement im Dienste unserer Brüder und Schwestern verstanden wird: "Es handelt sich in erster Linie um eine Frage der gegenseitigen Abhängigkeit, die als ein System von Beziehungen empfunden wird, das in der heutigen Welt in ihren wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und religiösen Komponenten ein bestimmender Faktor ist, und die als moralische Kategorie angenommen wird. Wenn die Interdependenz erkannt wird, ist die entsprechende Antwort als moralische und soziale Haltung, als "Tugend", die Solidarität" (SRS 38).
Die Solidarität muss daher als Ziel und Kriterium der sozialen Organisation und als eines der Grundprinzipien der christlichen Soziallehre angesehen werden. Aber nicht als guter moralischer Wunsch, sondern als ein starkes Erfordernis der menschlichen Natur: Der Mensch ist ein Wesen für andere und kann sich nur in einer selbstverständlichen Offenheit für andere entwickeln.
Auch dies wird durch die Botschaft des Evangeliums unterstrichen, wie der SRS lehrt: "Das Bewußtsein der gemeinsamen Vaterschaft Gottes, der Brüderlichkeit aller Menschen in Christus, 'Söhne im Sohn', der Gegenwart und des lebensspendenden Wirkens des Heiligen Geistes wird unserer Sicht der Welt ein neues Kriterium für ihre Deutung geben. Über die bereits starken und engen menschlichen und natürlichen Bindungen hinaus wird ein neues Modell der Einheit des Menschengeschlechts im Lichte des Glaubens ins Auge gefasst, das letztlich zur Solidarität anregen soll. Dieses höchste Modell der Einheit, das das innige Leben des einen Gottes in drei Personen widerspiegelt, ist das, was wir Christen mit dem Wort 'Gemeinschaft' bezeichnen" (SRS 40).
Eine Gemeinschaft, die so stark ist, dass sie uns alle wirklich füreinander verantwortlich macht, denn was wir den anderen antun, das tun wir uns selbst an, und erst recht Jesus Christus (Mt 25,40.45).
Solidarität ist nicht zu verwechseln mit "einem Gefühl des vagen Mitleids oder der oberflächlichen Sympathie für die Übel so vieler Menschen, ob nah oder fern". Im Gegenteil, es ist die feste und beharrliche Entschlossenheit, sich für das Gemeinwohl einzusetzen: das heißt für das Wohl eines jeden" (SRS 38).
All diese Bemühungen um die gesellschaftliche Solidarität erhalten ihren Wert und ihre Kraft in einer Haltung der persönlichen Solidarität; so heißt es in der Enzyklika: "Die Ausübung der Solidarität innerhalb jeder Gesellschaft ist dann gültig, wenn ihre Mitglieder sich gegenseitig als Personen anerkennen" (SRS 39). Dies bedeutet, die Tendenz zur Anonymität in den menschlichen Beziehungen zu überwinden, "Einsamkeit" in "Solidarität" und "Misstrauen" in "Zusammenarbeit" umzuwandeln, Verständnis, gegenseitiges Vertrauen, brüderliche Hilfe, Freundschaft und die Bereitschaft zu fördern, sich für den anderen zu "verlieren". Denn "im Licht des Glaubens tendiert die Solidarität dazu, über sich selbst hinauszuwachsen und die spezifisch christlichen Dimensionen der völligen Unentgeltlichkeit, der Vergebung und der Versöhnung anzunehmen.
Auch wenn diese Haltung "ideal" und nicht sehr "realistisch" erscheint, sollte man nicht vergessen, dass dieses "Ideal" das einzige ist, das den Aufbau einer neuen Gesellschaft und einer besseren Welt ermöglicht, das eine echte Entwicklung des Einzelnen und der Gemeinschaften erlaubt und das einen echten und dauerhaften Frieden ermöglicht.
Sollicitudo rei socialis schlägt vor, dass alle Menschen, insbesondere die Christen, Verantwortung für die ganzheitliche Entwicklung aller anderen Menschen übernehmen sollten. Es ist ein mühsames Ideal, das ständige Anstrengungen erfordert, aber es wird durch die Gnade des Herrn getröstet.
Die Kirche verkündet die Wirklichkeit dieser Entwicklung, die in der Welt bereits im Gange, aber noch nicht vollendet ist; und sie bekräftigt auf der Grundlage der göttlichen Verheißung - die darauf abzielt, daß die gegenwärtige Geschichte nicht in sich selbst verschlossen bleibt, sondern für das Reich Gottes offen ist - auch die Möglichkeit, die Hindernisse zu überwinden, die dem ganzheitlichen Wachstum der Menschen im Wege stehen; sie vertraut daher auf die Verwirklichung einer wahren - wenn auch auf dieser Erde nur partiellen - Befreiung (vgl. SRS 26; 47).
Andererseits "hat die Kirche auch Vertrauen in den Menschen, obwohl sie das Böse kennt, zu dem er fähig ist, weil sie genau weiß, dass es - trotz der ererbten Sünde und der Sünde, die jeder begehen kann - genügend Qualitäten und Energien in der menschlichen Person gibt, dass es eine grundlegende "Güte" gibt (vgl. Gen 1, 31), weil er das Abbild des Schöpfers ist, der unter den erlösenden Einfluß Christi gestellt ist, "der sich in gewisser Weise mit jedem Menschen vereinigt hat" (vgl. Gaudium et spes, 22; Redemptor hominis, 8), und weil das wirksame Wirken des Heiligen Geistes "die Erde erfüllt" (Weish 1, 7)" (SRS 47).
Der AutorAntonino Piccione  Dostojewskis "Der Idiot": "Die Schönheit wird die Welt retten".
Dostojewskis "Der Idiot": "Die Schönheit wird die Welt retten". Dostojewski in der Theologie des 20. Jahrhunderts
Dostojewski in der Theologie des 20. Jahrhunderts