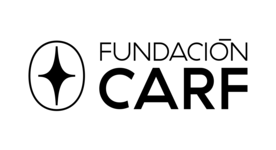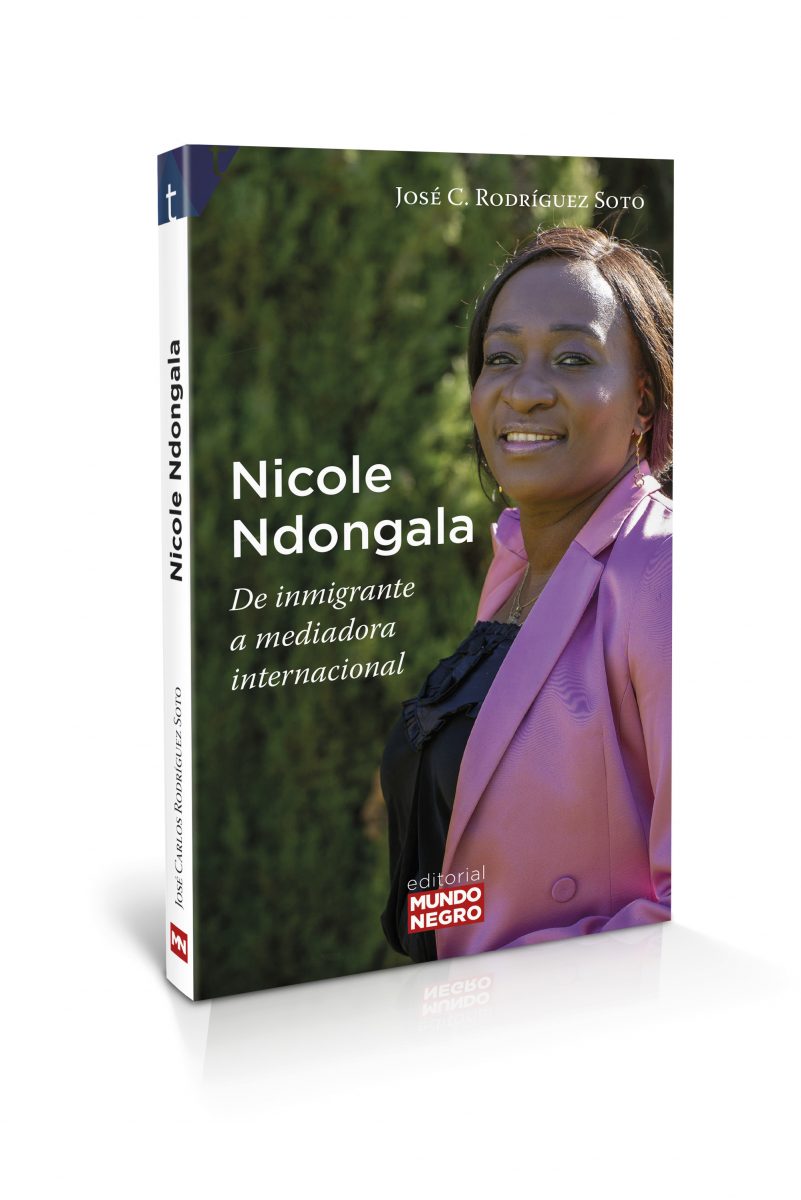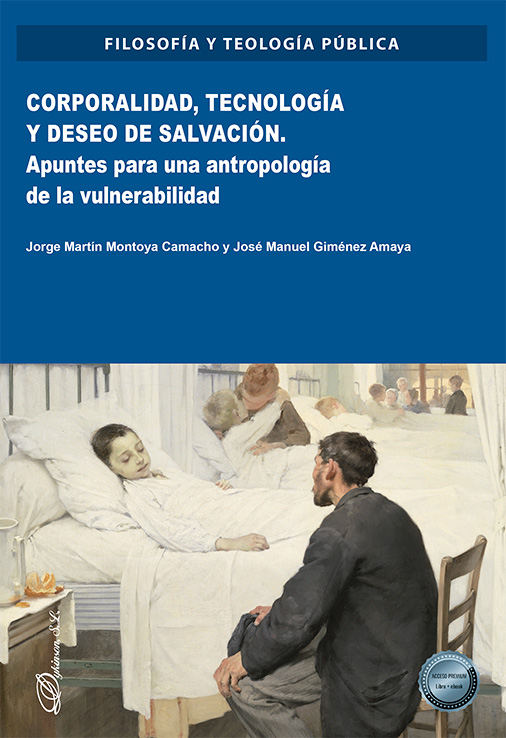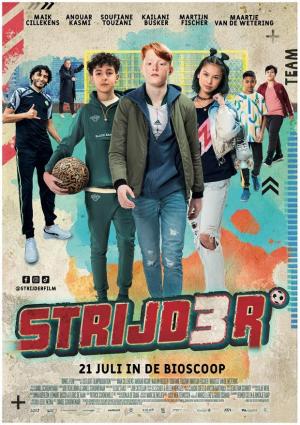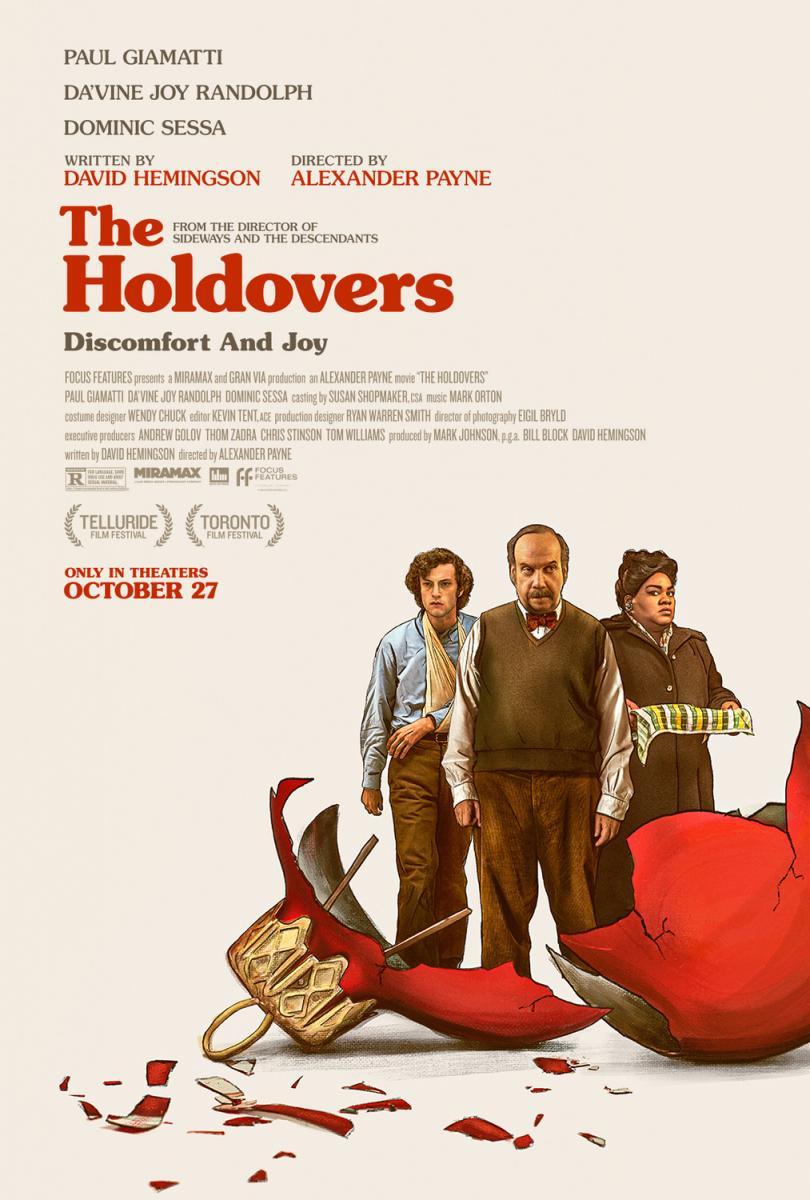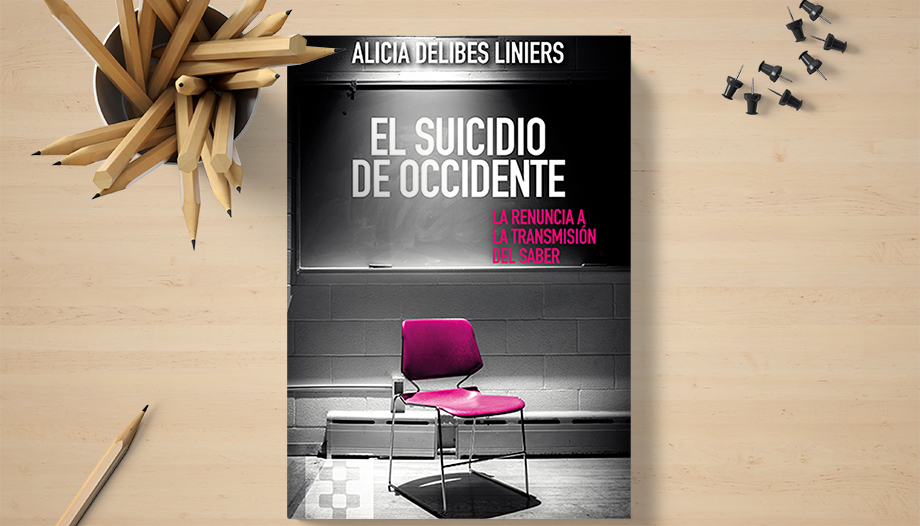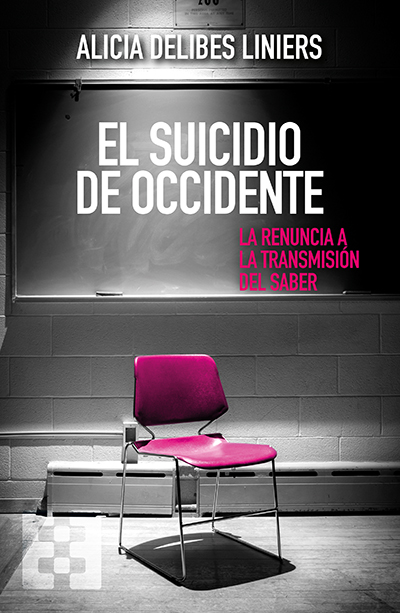Nähe des Papstes zu Marokko und Beifall für die seliggesprochene Familie Ulma
Nähe des Papstes zu Marokko und Beifall für die seliggesprochene Familie Ulma Eine Reise in den Süden. eSwatini entdecken
Eine Reise in den Süden. eSwatini entdeckenVon der Spitze von Tarifa, von Gibraltar und Südspanien, Afrika ist nur einen Katzensprung entfernt. Wer auf der Nationalstraße 340 in Andalusien unterwegs ist, kann sich leicht vom Panorama ablenken lassen und versuchen, jenseits des Meeres die grünen Berge des Schwarzen Kontinents (der dort nicht schwarz ist) zu erblicken. Eine andere Welt, eine andere Kultur, eine andere Mentalität nur wenige Kilometer entfernt, jenseits des Punktes, an dem das ruhige, warme Wasser des Mittelmeers auf die Meeresströmungen trifft und die schmalen, felsigen Strände von Tarifa bis Cádiz allmählich breiter und sandiger werden.
Das ist Marokko, auf Arabisch Maghreb (wörtlich: Westen, denn es ist der westlichste Punkt der arabischen Welt), mit Blick über die blaue Straße von Gibraltar hinaus, mit ihren weißen Häusern, die sich in den Medinas aneinander lehnen, den geheimnisvollen Reichsstädten, der Wüste Sahara, den Konflikten und den Menschen, die sie bewohnen, den Migranten, die versuchen, nach Europa zu entkommen.
Einige Fakten über Marokko
Marokko ist seit 1990 eine konstitutionelle Monarchie (zuvor war es eine absolute Monarchie mit starken islamisch-religiösen Konnotationen). Das Land hat eine Fläche von 710 850 km² und etwa 37 Millionen Einwohner.
Es zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus, die sowohl vom Atlantik als auch vom Mittelmeer umspült wird, auf ihrer gesamten Länge vom Atlasgebirge (mit Gipfeln von über 4.000 Metern Höhe) durchzogen ist und auf einem großen Teil ihrer Fläche von der Wüste Sahara geprägt wird.
Sein Name in den europäischen Sprachen ("Marokko" auf Spanisch, "Maroque" auf Französisch, "Morocco" auf Englisch, "Marocco" auf Italienisch) leitet sich nicht von der offiziellen arabischen Ortsbezeichnung (Maghreb) ab, sondern von einer seiner berühmtesten Städte, Marrakesch (arabisch: مراكش, Marrākush), die sich wiederum vom berberischen Mur-Akush (bedeutet "Land Gottes") ableitet.
Das Staatsoberhaupt ist König Mohammed VI.
Maghreb und Maschrik
In den Artikeln, die folgenden Themen gewidmet sind Syrien, Libanon, Ägypten, Irak, Israel y PalästinaWir haben bereits auf die starke Unterscheidung in der arabischen Welt zwischen Maghreb (arabisch für "Westen", d. h. der Teil Nordafrikas, der Mauretanien, Marokko und die Westsahara, Algerien, Tunesien und Libyen umfasst) und Maschrik (arabisch für "Osten", d. h. Ägypten - Sudan sowie die Länder am Golf und auf der arabischen Halbinsel, die eine gesonderte Erörterung verdienen - Israel/Palästina, Libanon, Syrien, Jordanien, Irak) hingewiesen.
Im Allgemeinen kann dieser Unterschied auf eine Reihe von Aspekten zurückgeführt werden:
Der Maghreb ist durch eine starke Berberpräsenz gekennzeichnet (man kann sagen, dass ein großer Teil der Bevölkerung berberischen Ursprungs ist, auch wenn die Mehrheit heute Arabisch spricht), während der Maschrik, auch wenn er gleichzeitig mit dem Maghreb "arabisiert" und islamisiert wurde, ein bereits semitisches Substrat aufweist (d. h. von Bevölkerungen, die semitische Sprachen sprachen, die zur gleichen Familie wie das Arabische gehören, wie Hebräisch, Aramäisch in seinen verschiedenen Formen usw.).
-Der Maghreb ist religiös weit weniger zusammengesetzt als der Maschrik. Der Maghreb ist traditionell reich an zahlreichen jüdischen Gemeinden, und obwohl er insbesondere ab dem 11. und 12. Jahrhundert die Wiege christlicher Heiliger wie Augustinus war, sind die christlichen Gemeinden in Nordafrika, mit Ausnahme Ägyptens, praktisch verschwunden, während die Juden dort zahlreich geblieben sind. Der Maschrik hingegen beherbergt die größten christlichen Gemeinden in der arabisch-islamischen Welt (Ägypten, Irak, Libanon, Syrien).
-Seit dem 19. Jahrhundert ist Frankreich als Kolonialmacht im Maghreb vorherrschend, während im Maschrik (mit Ausnahme von Syrien und dem Libanon) Großbritannien die Oberhand gewonnen hat. Die am weitesten verbreitete europäische Sprache in Nordafrika ist daher Französisch (abgesehen von der Westsahara, einer ehemaligen spanischen Kolonie, und Libyen, einer ehemaligen italienischen Kolonie), während es im Maschrik Englisch ist.
-Was die islamischen Rechtsschulen betrifft, so ist im Maghreb die malikitische Schule vorherrschend, im Maschrik je nach Land eine der drei anderen (im sunnitischen Islam gibt es vier Rechtsschulen oder Madhabs, die das religiöse, rechtliche und politische Denken beeinflussen, wobei die Unterschiede von einer Schule zur anderen nicht unerheblich sein können: die Malikiten, die Schafi'ita, die Hanbaliten und die Hanafiten).
Araber und Berber
Etwa 65% der Marokkaner sind arabische Muttersprachler, aber berberischen Ursprungs. Der Rest der Bevölkerung spricht Berber (in verschiedenen Dialekten) als Muttersprache.
Man kann sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, wenn auch nicht berberischsprachig, so doch mit der ethnisch-sprachlichen Gruppe der Berber verwandt ist. Auch wenn das arabischsprachige Element auf die Einwanderung von Stämmen aus Arabien während des Mittelalters und die Arabisierung (die mit der Islamisierung einherging) eines Teils der Einheimischen zurückzuführen ist, ist die vorherrschende ethnische Gruppe, insbesondere im Atlasgebiet, die der Berber.
Das Berberische ist wie das Arabische eine Sprache, die zu der großen Gruppe der afroasiatischen oder kamitischen Sprachen gehört, die sich in das Kamitische (Berbersprachen, Altägyptisch und andere) und das Semitische (Arabisch, Hebräisch, Akkadisch, Amharisch usw.) unterteilt. Es teilt also einige morphologische Merkmale mit dem Arabischen, ist aber lexikalisch und phonetisch völlig verschieden. Während das semitische Element seit der Antike in Nordafrika präsent ist (mit den Phöniziern, den Karthagern und den von ihnen gegründeten Kolonien), haben die Berberstämme und -völker zumindest in der Anfangszeit stolz der Islamisierung und Arabisierung widerstanden und trotz Diskriminierung heute eine schrittweise offizielle Anerkennung erlangt, insbesondere in Marokko, wo das Berberische neben dem Arabischen eine Amtssprache ist.
Das Ethnonym "Berber" leitet sich möglicherweise vom arabischen "barbar" oder, was wahrscheinlicher ist, vom lateinischen "barbarus" oder dem griechischen "barbaros" ab, wobei die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs "eine unverständliche Sprache sprechen" ist. Die Berber ihrerseits ziehen es vor, sich "Amazigh" (berberisch für "freie Männer") zu nennen und ihre Sprache "Tamazight" zu nennen, d. h. die Sprache der freien Männer. Es muss gesagt werden, dass das Berberische keine Sprache im eigentlichen Sinne ist, sondern ein sprachliches Kontinuum von Idiomen, die nicht immer gegenseitig verständlich sind (und es gibt mehrere zwischen Tunesien, Algerien, Marokko und Libyen), so wie sich die verschiedenen arabischen Dialekte auf das klassische Arabisch als ihre Ursprungssprache beziehen. Es handelt sich nicht um eine Schriftsprache, da die verschiedenen Bevölkerungsgruppen seit jeher Arabisch als Schriftsprache verwendet haben, auch wenn es alte Alphabete wie "Tuareg" oder "Typhinagh" gibt.
Heute, insbesondere nach der Anerkennung einiger Berberdialekte als Amtssprachen in Marokko und Algerien, wird eine schriftliche "Koine" identifiziert.
Eine kleine Geschichte von Marokko
Die ersten bekannten Bewohner Marokkos waren die Berber, die bereits im zweiten Jahrtausend v. Chr. in der Region ansässig waren. Wie bereits erwähnt, entstanden ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. die ersten Kolonien, zunächst die phönizischen und dann die karthagischen, in diesem Gebiet.
Ab 146 n. Chr. jedoch, mit dem Ende der Punischen Kriege und dem anschließenden Fall Karthagos, kam das geografische Gebiet, das dem heutigen Marokko entspricht, unter römische Kontrolle und wurde in die Provinz Mauretania Tingitana eingegliedert. Nach dem Ende des Römischen Reiches wurde das Land von den Vandalen erobert und kam dann zum Byzantinischen Reich.
Der Islam kam im 7. Jahrhundert mit der arabischen Eroberung nach Marokko und bewirkte einen tiefgreifenden kulturellen und religiösen Wandel. Mehrere arabische Dynastien kamen an die Macht, darunter die Idrisiden, die 789 die Stadt Fes gründeten, die später zu einem wichtigen kulturellen und religiösen Zentrum wurde. Im Mittelalter erlebte Marokko den Aufstieg der Almoraviden und Almohaden, die ihre Herrschaftsgebiete auf weite Teile Nordafrikas und Spaniens ausdehnten.
Von grundlegender Bedeutung für die marokkanische Geschichte war auch der Exodus der Mauren aus Spanien nach der Rückeroberung, der nicht nur die Ankunft von Zehn- oder besser Hunderttausenden von Flüchtlingen, sowohl "Mauren" (Araber und Berber) als auch Juden von der Iberischen Halbinsel, sondern auch die soziale und kulturelle Umgestaltung des Landes mit sich brachte. Die Neuankömmlinge wurden zur städtischen Elite und siedelten sich mit erheblichem kulturellem Einfluss in sprachlicher, architektonischer und musikalischer Hinsicht in den bekanntesten Städten (den vier "Reichsstädten": Meknes, Fes, Rabat, Marrakesch), aber auch in Tanger und in mehreren Küstenstädten, vor allem am Mittelmeer, an (wovon der maurische Stil zeugt). Die sephardischen Juden, die nach Marokko kamen und sich in den Mellahs der marokkanischen Städte niederließen, haben das Judenspanische als Umgangssprache bis in die Gegenwart beibehalten.
Im 16. Jahrhundert wurde Marokko von den Saaditen regiert, einer Dynastie, die sowohl die Angriffe der Osmanen (Marokko war nie Teil der Pforte) als auch der Portugiesen abwehrte und die Autonomie des Landes festigte. Die Dynastie der Alawiten, die immer noch an der Macht ist, entstand 1659 (ihre Mitglieder behaupten, dass ihre Vorfahren auf Mohammed zurückgehen). Unter ihrer Herrschaft blieb das Land trotz des kolonialen Drucks der Europäer unabhängig, obwohl es vor allem ab dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert unter dem wachsenden Einfluss zweier Mächte stand: Frankreich und Spanien. Im Jahr 1912 gelang es Frankreich und Spanien, zwei getrennte Protektorate zu errichten, das französische im Norden (Marokko selbst) und das spanische im Süden (Westsahara).
Die Unabhängigkeitsbewegung, die von Persönlichkeiten wie Mohammed V. angeführt wurde, führte zum Ende des Protektorats im Jahr 1956, als Marokko ein unabhängiges Königreich wurde (und 1976 die Westsahara annektierte, die bis 1975 zu Spanien gehört hatte).
Seitdem hat das Land trotz des Zwiespalts zwischen Tradition und Moderne, Diktatur und Zeiten größerer Freiheit eine ununterbrochene Phase der Modernisierung und Entwicklung unter der Führung der Könige Mohammed V., Hassan II. und Mohammed VI. erlebt, dem amtierenden Herrscher. Vor allem letzterem sind die großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen zu verdanken, die Marokkos Position als einer der stabilsten und fortschrittlichsten Staaten Nordafrikas gefestigt haben.
Die Armut und das große wirtschaftliche Gefälle in der Bevölkerung sind jedoch neben der Westsahara-Frage und der Geißel der Auswanderung nach wie vor echte Probleme in der Region.