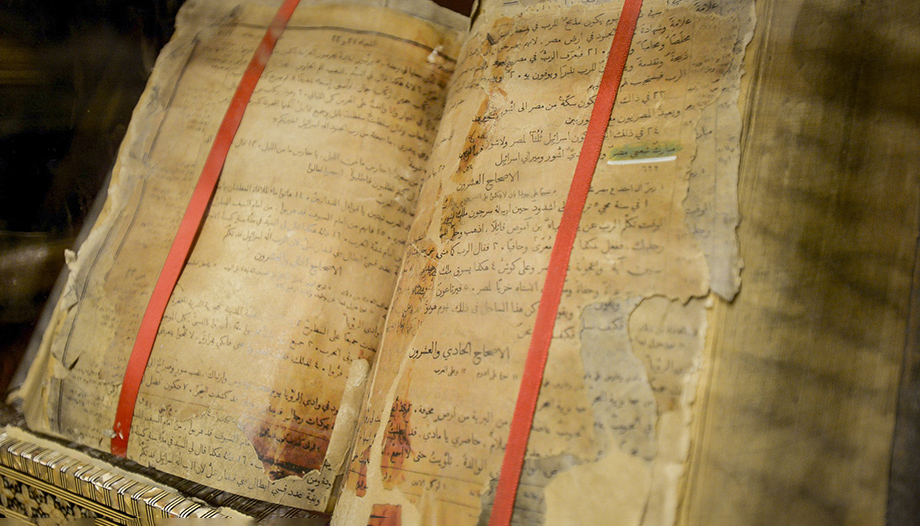Das Christentum, obwohl es mit einem Buch in der Wiege geboren wurde - das Bild stammt von Luther, für den die Bibel die Krippe war, in die Jesus gelegt wurde -, ist keine Buchreligion sondern eine Religion der Tradition und der heiligen Schriften. Das war auch das Judentum, insbesondere vor der Zerstörung des Tempels. Dieser Hinweis wird deutlich, wenn man über vergleichende Religionen spricht. (M. Finkelberg & G. Stroumsa, Homer, die Bibel und darüber hinaus: literarische und religiöse Kanons in der antiken Welt)..
Eine Reihe von Faktoren - mehr praktischer als theoretischer Art - haben jedoch zu einer gewissen Verwirrung geführt. Theoretiker des kollektiven Gedächtnisses (J. Assmann) weisen darauf hin, dass 120 Jahre nach einem Gründungsereignis das kommunikative Gedächtnis einer Gemeinschaft in einem kulturellen Gedächtnis verankert ist, in dem kulturelle Artefakte den Zusammenhalt zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellen.
Religiöse oder kulturelle Gemeinschaften, die langfristig überleben, zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass sie der textlichen Verbindung den Vorrang vor der rituellen Verbindung geben.
Das ist mehr oder weniger das, was zu Beginn des dritten Jahrhunderts in der Kirche geschah, als die Theologie als Kommentar zur Heiligen Schrift konzipiert wurde. Später, mit dem Aufkommen des Islam, der von Anfang an eine Buchreligion war, und der Entwicklung des Judentums als Religion ohne Tempel, wurde die Idee der Offenbarungsreligionen mit den Buchreligionen gleichgesetzt: Das Christentum, eine Offenbarungsreligion, wurde so an einen Platz gestellt, der ihm nicht zustand: eine Religion des Buches.
Drittens haben Luther und die Väter der Reformation mit ihrer Reduzierung des Traditionsbegriffs auf den bloßen Kirchenbrauch (consuetudines ecclesiae)den Grundsatz der Tradition zugunsten der Sola Scriptura.
Schließlich akzeptierte die Aufklärung mit ihrem Misstrauen gegenüber der Tradition nur eine Schriftauslegung, die auch und vor allem der Tradition gegenüber kritisch war.
In den reformatorischen Gemeinden führte die Abfolge dieser Faktoren oft zu einer doppelten Auslegung der Schrift: Entweder wurde die Botschaft in dem von der Kritik vorgeschlagenen Säkularismus aufgelöst, oder man verzichtete auf die Kritik und landete im Fundamentalismus.
Tradition in der katholischen Kirche
In der katholischen Kirche hingegen war der Ansatz ein anderer. Seit Trient bezog sie sich auf die apostolische Traditionen -die der apostolischen Zeit, nicht die Bräuche der Kirche- als inspiriert (dictatae) durch den Heiligen Geist und dann an die Kirche weitergegeben. Daher empfing und verehrte die Kirche mit gleicher Zuneigung und Verehrung (pari pietatis affectu ac reverentia) sowohl die heiligen Bücher als auch diese anderen Traditionen.
Später hat das Zweite Vatikanische Konzil das Verhältnis zwischen Schrift und Tradition etwas geklärt. Es bekräftigte zunächst, dass die Apostel das Wort Gottes durch die Schrift und die Überlieferungen weitergegeben haben - die Überlieferung wird also als konstitutiv und nicht nur als auslegend verstanden, wie es in den protestantischen Bekenntnissen der Fall ist -, aber es wies auch darauf hin, dass die Schrift durch die Inspiration das Wort Gottes weitergibt, indem sie Wort ist (locutio) von Gott.
Die Tradition hingegen ist lediglich eine Überlieferung des Wortes Gottes (vgl. Dei Verbum 9). Er schlug sie auch aus einer anderen Perspektive vor: "Die Kirche hat die Heilige Schrift immer als den Leib des Herrn selbst verehrt [...]. Sie hat sie immer als den Leib des Herrn selbst betrachtet und betrachtet sie auch heute noch, zusammen mit der Heiligen Überlieferung (una cum Sacra Traditione), als oberste Regel ihres Glaubens, da sie, von Gott inspiriert und ein für allemal geschrieben, unveränderlich das Wort Gottes selbst wiedergeben". (Dei Verbum 21).
Dabei darf nicht aus den Augen verloren werden, dass der Gegenstand der Sätze die Heilige Schrift ist. Aber in der Kirche wurde die Heilige Schrift immer von der Tradition begleitet und geschützt. Dieser Aspekt ist zumindest teilweise von protestantischen Denkern aufgegriffen worden, die im ökumenischen Dialog den Ausdruck Sola Scriptura numquam solaDas Prinzip der Sola Scriptura bezieht sich in der protestantischen Logik auf den Wert der Heiligen Schrift, nicht auf ihre historische Realität, die sicherlich nunquam sola. Man kann also sagen, dass sich die katholische und die protestantische Position einander angenähert haben. Der Kern der Frage bleibt jedoch das innere Verhältnis zwischen der Schrift und den Überlieferungen innerhalb der apostolischen Tradition, d.h. dem, was von den Aposteln an ihre Nachfolger weitergegeben wurde und in der Kirche noch lebendig ist.
Apostolische Tradition
Es ist schon oft erwähnt worden, dass Jesus Christus die Apostel nicht zum Schreiben, sondern zum Predigen gesandt hat.
Sicherlich haben sich die Apostel, wie Jesus Christus vor ihnen, des Alten Testaments, d.h. der Schriften Israels, bedient. Sie verstanden diese Texte als Ausdruck der Verheißungen Gottes - und in diesem Sinne auch als Prophezeiung oder Verkündigung -, die sich in Jesus Christus erfüllt hatten. Sie brachten auch die Weisung (Tora) Gottes an sein Volk sowie der Bund (Bestimmung, Testament), den Jesus zur Erfüllung bringt.
Die neutestamentlichen Texte hingegen sind keine Fortsetzung oder Nachahmung der Texte Israels. Keiner von ihnen stellt sich als Kompendium des Neuen Bundes dar. Sie sind alle als partielle - und in einigen Fällen umständliche - Ausdrücke des von den Aposteln verkündeten Evangeliums entstanden.
In der Generation, die auf die der Apostel folgte, lag das Prinzip der Autorität auf jeden Fall in den Worten des Herrn, dann in den Worten der Apostel und schließlich in den Worten der Schrift - wie zuvor bei Paulus, als er zwischen dem Gebot des Herrn und seinem eigenen unterschied (1 Kor 7,10-12). Dies zeigt sich auch bei den apostolischen Vätern, Klemens, Ignatius von Antiochien, Polykarp usw., die als Autoritätsargumente abwechselnd die Worte Jesu, der Apostel oder der Heiligen Schrift anführen.
Die Textform dieser Worte stimmt jedoch kaum mit dem überein, was wir in den kanonischen Texten erhalten haben: Die Texte dienten eher als Gedächtnisstütze für die mündliche Verkündigung als als heilige Texte.
In den letzten Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts ist ein Wandel der Einstellung zu beobachten. Zwei Faktoren tragen zu diesem Wandel bei.
Auf der einen Seite steht das Christentum in Kontakt und in Kontrast zu den entwickelten intellektuellen Weltanschauungen, insbesondere zum Mittelplatonismus - einem Platonismus, der von moralischem Stoizismus durchdrungen ist - und zu den Gnosis Jahrhunderts, die die Erlösung durch Wissen vorschlug. Einige gnostische Lehrer sahen im Christentum - der Ausdruck stammt von Ignatius von Antiochien - eine Religion, die mit ihrer Weltanschauung in Einklang stehen konnte. Basilides war zu Beginn des zweiten Jahrhunderts vielleicht der erste, der die Schriften des Neuen Testaments als Grundlagentexte für seine gnostische Lehre verstand, und andere wie Valentinus und Ptolemäus, bereits in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, waren scharfe Ausleger der Heiligen Schrift, die sie mit ihrem System in Einklang brachten.
Der heilige Justinus, ein Zeitgenosse und vielleicht auch Kollege von Valentinus, wies bereits darauf hin, dass die Lehren dieser Lehrer das Christentum in den Gnostizismus auflösten und dass ihre Autoren daher Ketzer waren - Justin ist es, der das Wort im Sinne von Abweichung prägte, da es zuvor nur Schule oder Fraktion bedeutete -, ohne jedoch tiefgreifende Gründe vorzuschlagen. Jahrhunderts ist die Vorstellung einer zuverlässigen mündlichen Überlieferung bereits geschwächt: Es gibt keine Jünger der Jünger der Jünger der Apostel mehr - vielleicht ist der heilige Irenäus die Ausnahme. Wenn dies in einer kulturellen oder religiösen Gemeinschaft geschieht, schaffen die Gemeinschaften, wie bereits erwähnt, Artefakte, die ein bestimmtes kulturelles oder religiöses Gedächtnis bewahren, und das Artefakt der Verbindung par excellence ist die Schrift.
Die große Kirche, die den gnostischen Häretikern misstrauisch gegenüberstand, traf drei Entscheidungen, die zusammen ihre Identität bewahrten. Benedikt XVI. (vgl. Rede beim ökumenischen Treffen, 19.08.2005) hat mehr als einmal auf sie Bezug genommen: erstens die Festlegung des Kanons, in dem Altes und Neues Testament eine einzige Schrift bilden; zweitens die Formulierung der Idee der apostolischen Sukzession, die an die Stelle des Zeugnisses tritt; schließlich der Vorschlag "Die Regel des Glaubens als Kriterium für die Auslegung der Heiligen Schrift.
Die Bedeutung des Heiligen Irenäus
Obwohl diese Formulierung bei vielen Theologen der Zeit - Clemens von Alexandrien, Origenes, Hippolyt, Tertullian - zu finden ist, ist es am Vorabend des 1900-jährigen Jubiläums seines Geburtstages fast obligatorisch, auf den heiligen Irenäus zu schauen, um die Modernität seines Denkens zu entdecken.
Sein wichtigstes Werk, Entlarvung und Widerlegung der vorgeblichen, aber falschen Gnosisim Volksmund bekannt als Gegen Irrlehren, berücksichtigt alles, was bisher gesagt worden ist. Nach einigen Vorbemerkungen beginnt er wie folgt: "Die Kirche, die sich im ganzen Universum bis an die Enden der Erde ausgebreitet hat, hat von den Aposteln und ihren Jüngern den Glauben an den einen Gott, den Vater, den allumfassenden Herrscher, der geschaffen hat ... und an den einen Jesus Christus, den Sohn Gottes, der zu unserem Heil Fleisch geworden ist, und an den Heiligen Geist, der durch die Propheten ...".. Der hl. Irenäus folgt dem Text mit einer Formel, die er an anderer Stelle als die "Regel (Kanon, auf Griechisch) des Glaubens [oder der Wahrheit]". Diese Glaubensregel hat keine feste Form, da sie, von den Aposteln überliefert, immer mündlich bei der Taufe oder in Taufkatechesen weitergegeben wird. Sie bezieht sich immer auf das Bekenntnis zu den drei göttlichen Personen und dem Wirken jeder einzelnen von ihnen.
Sie ist überall in der Kirche zu erkennen, die "...] und predigt, lehrt und überliefert sie [...]. Die Kirchen Germaniens glauben nicht anders, noch übermitteln sie eine andere Lehre als die, die von den Kirchen Iberiens gepredigt wird". (ebd. 1, 10, 2). Daher ist sie, wie die apostolische Tradition, öffentlich: "ist in jeder Kirche präsent, um von denen wahrgenommen zu werden, die es wirklich sehen wollen". (ebd. 3, 2, 3), im Gegensatz zum Gnostischen, das geheim und den Eingeweihten vorbehalten ist.
Darüber hinaus könnte die Regel ausreichend sein, da sie "Viele barbarische Völker stimmen dieser Weihe zu und glauben an Christus, ohne Papier und Tinte [...], indem sie die alte Tradition sorgfältig bewahren und an einen Gott glauben. [folgt einem anderen trinitarischen Bekenntnis, einem Ausdruck der Glaubensregel]" (ebd. 3, 4, 1-2).
Doch die Kirche hat eine Sammlung von Schriften: "Die wahre Gnosis ist die Lehre der Apostel, die uralte Struktur der Kirche in der ganzen Welt und das, was für den Leib Christi typisch ist, der durch die Nachfolge der Bischöfe gebildet wird, denen die Kirche ihren eigenen Namen gegeben hat. [die Apostel] die den Kirchen eines jeden Ortes anvertraut sind. So kommt uns ohne Fiktion die Bewahrung der Heiligen Schrift in ihrer Gesamtheit zu, ohne etwas wegzunehmen oder hinzuzufügen, ihre Lektüre ohne Betrug, ihre rechtmäßige und liebevolle Darlegung gemäß der Heiligen Schrift selbst, ohne Gefahr und ohne Gotteslästerung". (ibid. 4, 33, 8).
Auf den letzten Punkt ist das Augenmerk zu richten. Die Regel (Kanon) des Glaubens ist derjenige, der die Schrift richtig auslegt (ebd. 1, 9, 4), denn sie stimmt mit ihr überein, da die Schrift selbst die Regel des Glaubens erklärt (ebd. 2, 27, 2) und die Regel des Glaubens mit der Schrift entfaltet werden kann, wie es der heilige Irenäus in seinem Traktat Demonstration (Epideixis) der apostolischen Verkündigung.
Diese gegenseitige Durchdringung zwischen der Glaubensregel und der Heiligen Schrift erklärt auch andere Aspekte. Erstens wird jede der Schriften durch die anderen Schriften richtig interpretiert. Zweitens: Im Laufe der Zeit wird das Wort "Regel/Kanon", wird in erster Linie auf den Kanon der Heiligen Schrift angewandt, der auch die Regel des Glaubens ist.
Professor für Neues Testament und biblische Hermeneutik, Universität von Navarra.