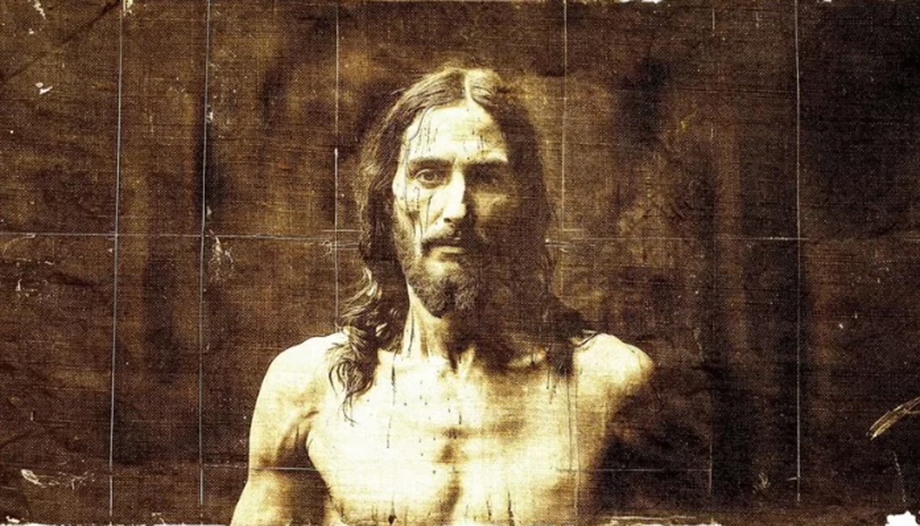Wir leben in einer Zeit der großen Unsicherheit. Wir glauben oft blind, was uns Influencer in den sozialen Medien vorschlagen, ohne tiefer zu graben. Doch wir sind hungrig nach Wahrheit und Gewissheit.
Dasselbe ist in den letzten beiden Jahrhunderten mit dem christlichen Glauben geschehen: Mit der Aufklärung und der Säkularisierung wurden viele Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt, bis hin zur Leugnung der historischen Existenz von Jesus von Nazareth und seiner göttlichen Identität. Gleichzeitig wird selbsternannten Historikern Anerkennung gezollt, die Theorien ohne Quellen und solide Grundlagen verbreiten.
Für diejenigen, die sich der historischen Gestalt Jesu nähern wollen, werden wir einen Überblick über die Quellen und Methoden der Forschung über den Nazarener geben, der sich an eine Reihe von Artikeln anschließt, die bereits von Omnes über das Leben von Jesus von Nazareth, sein kulturelles und geografisches Umfeld und seinen Tod veröffentlicht wurden.
Was ist Geschichte?
Lassen Sie uns zunächst definieren, was Geschichte ist. Zunächst ist festzustellen, dass sich der Begriff vom griechischen ἱστορία (historia) ableitet, was Forschung bedeutet, und die gleiche Wurzel ιδ- hat wie das Verb ὁράω (orao, sehen, sehen, Verb mit drei Wurzeln: ὁρά-; ιδ-; ὄπ-). Das Perfekt ὁίδα, òida, bedeutet also wörtlich "ich habe gesehen", aber im weiteren Sinne auch "ich weiß". Es bezieht sich in der Praxis auf das Beobachten und folglich auf das Wissen nach dem Erleben: den gleichen Sinn finden wir auch in der Wurzel des lateinischen Verbs video (v-id-eo und im griechischen Ursprungsbegriff "Idee"). Ich füge hinzu, dass eine Voraussetzung für die historische Forschung neben dem kritischen Sinn auch die Intelligenz im wörtlichen Sinne des lateinischen Wortes intus lĕgĕre ist, d. h. in sich hineinzulesen, tiefer zu gehen und die Fähigkeit zu bewahren, die Gesamtheit der Fakten und Ereignisse zu betrachten.
Die historisch-kritische Methode
Die Aufklärung ließ Zweifel an der Figur des Nazareners aufkommen, aber sie förderte auch die Entwicklung der historischen Forschung durch die historisch-kritische Methode, die darauf abzielt, die Zuverlässigkeit der Quellen zu bewerten. Diese seit dem 17. Jahrhundert entwickelte Methode wird nicht nur auf die Evangelien, sondern auf jeden in verschiedenen Varianten überlieferten Text angewandt, um seine ursprüngliche Form zu rekonstruieren und seinen historischen Inhalt zu überprüfen.
In den letzten 150 Jahren hat die Notwendigkeit, die christliche Lehre historisch zu begründen, die katholische Kirche dazu veranlasst, die Historizität der Evangelien nachdrücklich zu bekräftigen, während Historiker, Gelehrte und Archäologen die historisch-kritische Methode angewandt haben, um zwischen dem "historischen Jesus" und dem "Christus des Glaubens" zu unterscheiden. Eine allzu ideologische Anwendung dieser Methode hat jedoch häufig zu einer klaren Trennung zwischen dem vorchristlichen Jesus und dem "Christus des Glaubens" geführt. Ostern und der nachösterliche Christus. Um auf diese Zweifel zu antworten, hat die Kirche die exegetischen und archäologischen Studien vertieft und auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil ("...") bekräftigt, dass "die Antwort der Kirche auf diese Zweifel dieselbe war wie die Antwort der Kirche auf den Osterchristus".Dei Verbum") "fest und ohne jedes Zögern die Geschichtlichkeit" der Evangelien, die "getreu wiedergeben, was Jesus, der Sohn Gottes, während seines Lebens unter den Menschen tatsächlich für ihr ewiges Heil getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde".
Die Position der Kirche vereint also den "historischen Jesus" und den "Christus des Glaubens" in einer einzigen Figur. Die große Mehrheit der Historiker - ob Christen, Juden, Muslime oder Nichtgläubige - zweifelt jedoch nicht an der historischen Existenz des Jesus von Nazareth. Im Gegenteil, die historischen und archäologischen Beweise zu seinen Gunsten häufen sich, was die Zuverlässigkeit der Evangelien und anderer Schriften des Neuen Testaments untermauert.
Der "historische Jesus"-Ansatz
Heute sind sich die meisten Historiker über die historische Existenz Jesu einig, und es gibt immer mehr historische und archäologische Beweise, die dies bestätigen. Das liegt daran, dass sich die historische Forschung zu seiner Person in drei Hauptphasen entwickelt hat:
- Die erste oder alte Suche, die von Hermann S. Reimarus (1694-1768) eingeleitet und von Gelehrten wie Ernest Renan, dem Autor des berühmten "Lebens Jesu", fortgesetzt wurde. Diese vom aufgeklärten Rationalismus beeinflusste Phase leugnete systematisch alle erstaunlichen Fakten, die mit der Gestalt Jesu in Verbindung stehen, ohne seine Existenz in Frage zu stellen. Sie stieß jedoch bald an ihre eigenen ideologischen Grenzen, wie Albert Schweitzer hervorhob. In der Tat hat keiner der Protagonisten dieser Forschungsphase jemals den historischen Kontext und die archäologischen Quellen berücksichtigt, auch wenn Renan selbst Palästina romantisch als "fünftes Evangelium" bezeichnete.
- New Quest oder Second Quest, offiziell 1953 von dem lutherischen Theologen Ernst Käsemann initiiert, in Wirklichkeit aber bereits von Albert Schweitzer, der auf die Grenzen der ersten Phase hinwies. Sie stand im Gegensatz zu einer früheren Phase, die No Quest genannt wurde und von Rudolf Bultmann vertreten wurde, der überzeugt war, dass die historische Forschung über Jesus für den christlichen Glauben irrelevant sei. Die Zweite Suche lehnte die ideologische Ablehnung des "Christus des Glaubens" ab und verfolgte einen kritischeren und integrativen Ansatz, der die erstaunlichen Ereignisse einbezog, ohne sie von vornherein auszuschließen.
- Dritte Suche, die heute vorherrschend ist.
Die dritte Suche
Während die erste Suche von einer rationalistischen Ideologie geprägt war und die zweite Suche einen ausgewogeneren Ansatz verfolgte, zeichnet sich die dritte Suche durch eine größere Aufmerksamkeit für den historischen Kontext und Interdisziplinarität aus, die Philologie, Archäologie und Hermeneutik verbindet. Dank dieser Methode haben wir heute ein immer solideres Bild von der historischen Existenz Jesu und seiner Bedeutung für die Geschichte des ersten Jahrhunderts.
Die Vertreter dieser Dritten Suche gehen von der von Albert Schweitzer formulierten Annahme aus, dass man nicht alles, was in den Evangelien und im Neuen Testament einen wunderbaren Charakter hat, ideologisch ablehnen kann, weil es nicht dem Kanon des aufgeklärten Rationalismus entspricht. Wie Benedikt XVI. (ein Vertreter der Dritten Suche, zusammen mit Schriftstellern und Wissenschaftlern wie den Italienern Giuseppe Ricciotti und Vittorio Messori, dem israelischen Juden David Flusser und dem Deutschen Joachim Jeremias) in seinem Buch Jesus von Nazareth hinzufügt, bestehen die Grenzen der historisch-kritischen Methode im Wesentlichen darin, "das Wort in der Vergangenheit zu belassen", ohne es "aktuell, heute" machen zu können; darin, "die vor uns liegenden Worte als Menschenworte zu behandeln"; schließlich darin, "die Bücher der Schrift nach ihren Quellen weiter zu unterteilen, aber die Einheit aller dieser Schriften als Bibel ergibt sich nicht als unmittelbare historische Tatsache".
Die Dritte Suche greift auf Textanalyse und Hermeneutik zurück, um der ursprünglichen Form der betrachteten Quellen (in diesem Fall derjenigen, die sich auf Jesus beziehen) so nahe wie möglich zu kommen, und schließt, wie gesagt, Gelehrte wie den israelischen Juden David Flusser (1917-2000) ein, Autor grundlegender Schriften über das antike Judentum und wie viele andere zeitgenössische Juden davon überzeugt, dass die Evangelien und die paulinischen Schriften die reichste und zuverlässigste Quelle für das Studium des Judentums des Zweiten Tempels darstellen, wie viele andere zeitgenössische Juden davon überzeugt, dass die Evangelien und die paulinischen Schriften die reichhaltigste und zuverlässigste Quelle für das Studium des Judentums des Zweiten Tempels darstellen, da andere zeitgenössische Materialien aufgrund der Zerstörung durch die Jüdischen Kriege (zwischen 70 und 132 n. Chr.) verloren gegangen sindc.).
In den folgenden Artikeln werden wir sehen, wie diese Methodik von der Kirche im Laufe der Jahrhunderte bereits auf historische und archäologische Quellen zur Gestalt Christi angewandt wurde.